![Solarthermie Wirtschaftlichkeit: Warum sich Solarthermie gerade jetzt lohnt [ 2023 ]](https://www.solaridee.de/wp-content/uploads/2022/11/Solarthermie-Wirtschaftlichkeit-Beitragsbild-300x169.jpg)
Menü
- Solarenergie AktuellesPolitikWissenschaft
- Photovoltaik HausKosten & FörderungStromspeicher
- Solarthermie
- Anbieter Vergleich
- Projekte
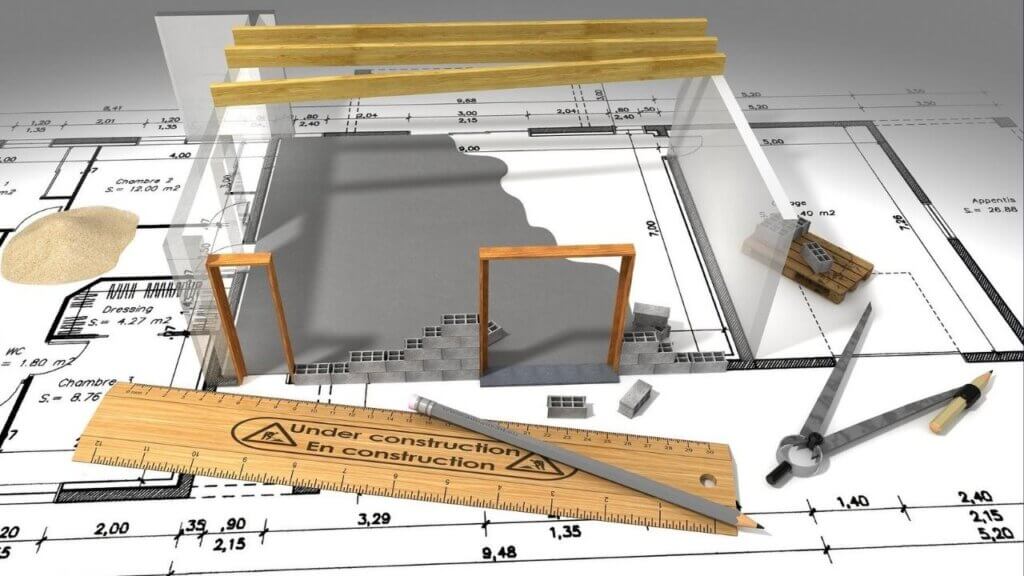
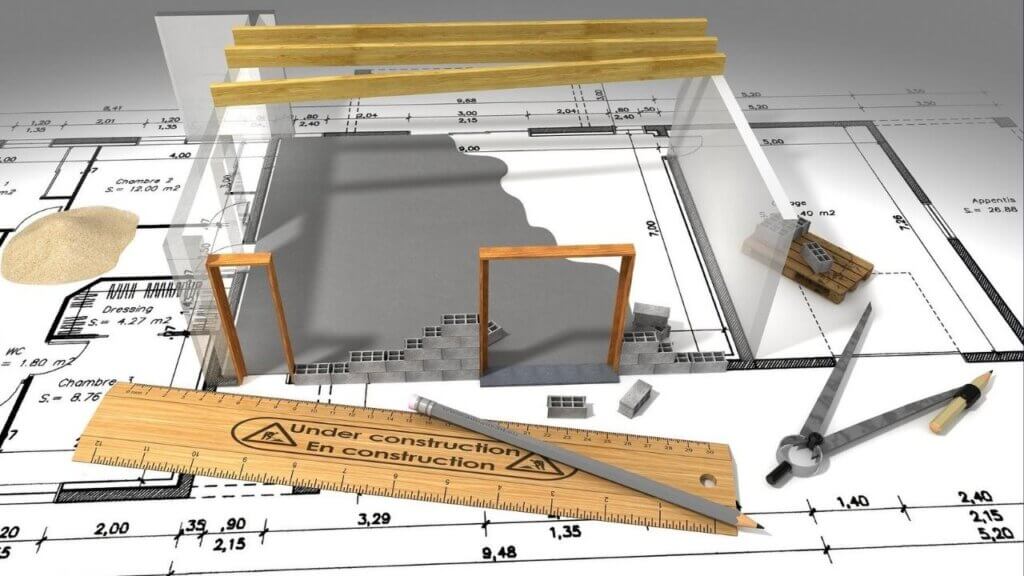
Solarwärme kann genutzt werden, um die Heizung zu unterstützen. Vor allem in den Übergangsmonaten im Herbst und Frühling ist das sehr effektiv, da es noch nicht allzu viel Heizleistung benötigt wird und gleichzeitig noch viel Sonnenenergie genutzt werden kann. Damit die Wärme dann auch tatsächlich genutzt werden kann, wird sie meist in einen Solarthermie Speicher geleitet. Eine andere Möglichkeit kann die Bauteil- bzw. Betonkernaktivierung sein: Hierbei werden Teile des Gebäudes als Energiespeicher genutzt.

Bei der Betonkernaktivierung wird der Baustoff Beton als Wärmespeicher genutzt. Dafür werden in den Beton Wasserleitungen eingelassen, durch die beispielsweise von einer Solarthermieanlage erwärmtes Wasser geleitet werden kann. Dadurch erwärmt sich der Beton, welcher die Wärme wiederum langsam wieder an den Raum abgibt. Bisher lohnt sich die Anwendung vor allem in großen Gebäuden wie Schulen, Büros oder Krankenhäusern.
Bei der Betonkernaktivierung wird Beton, der im Gebäude verbaut wird, als Wärmespeicher genutzt. Beton hat eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und wird ohnehin in den meisten Gebäuden verwendet – es eignet sich daher sehr gut als Wärmespeicher.
Thermische Bauteilaktivierung: Heizen und Kühlen mit Beton
Damit der Beton als Wärmespeicher genutzt werden kann, muss er an das Wärmenetz bzw. die Solarthermieanlage angeschlossen werden. Ähnlich wie bei einer Fußbodenheizung werden im Beton Leitungen verlegt, durch die das erwärmte Wasser fließen kann. Dabei geht die Wärme vom Wasser in den Beton über, der die Wärme wiederum über einen längeren Zeitraum an den Raum abgibt.
Die Speicherung von Solarwärme in den Bauteilen eines Gebäudes ist praktisch und hat viele Anwendungsmöglichkeiten – ist aber dennoch nicht immer die beste Lösung:
Größter Vorteil der Betonkernaktivierung ist sicherlich, dass Bauteile einen doppelten Nutzen erfüllen und damit insgesamt zur Effizienz des Hauses beitragen können.

Doppelt nützlich ist diese Art der Energiespeicherung auch, da das System nicht nur zum Wärmen, sondern auch zum Kühlen genutzt werden kann. Statt warmem Wasser durchläuft dann einfach kaltes Wasser die Leitungen und kann so einen Teil der Wärme aus dem Raum ableiten.
Um den Beton zu erwärmen und damit auch die Raumluft sind außerdem nur geringe Vorlauftemperaturen nötig. Damit eignet sich die Verwendung gut für die Kombination mit erneuerbaren Energien, die in der Regel geringere Vorlauftemperaturen erzeugen als es über fossile Brennstoffe der Fall wäre.
Dass der Beton zeitversetzt heizt bzw. kühlt, kann zum Vorteil werden: Denn dadurch kann der Beton auch nachts zu einem vergünstigten Nachttarif gekühlt werden und dann im Laufe des Tages Wärme aufnehmen und den Raum so kühlen.

Die Nutzung von Baustoffen als Wärmespeicher birgt aber auch Nachteile. Da der Einbau mit viel Aufwand und Planung verbunden ist, eignet sie sich quasi kaum für Wohnhäuser. Stattdessen werden solche Heizungsmöglichkeiten eher in Schulen, Büros oder Krankenhäusern genutzt.
Auch die Kosten sind in diesem Rahmen ein Nachteil, da sie zu hoch sind, um sich für Wohngebäude zu rentieren.
Hinzu kommt, dass mit dieser Art von Wärmesystem nur eine begrenzte Wärmeleistung möglich ist und diese auch eher auf gleichmäßige und langfristige Wärmeverteilung ausgelegt ist. Schwierig wird es also, wenn in verschiedenen Räumen unterschiedliche Temperaturen erreicht werden sollen. Auch hier ist die Betonkernaktivierung eher nicht die optimale Lösung.
Die Kosten für ein Heizsystem über Betonkernaktivierung hängen von verschiedenen Faktoren ab. Grob kann man mit Kosten zwischen 40 und 60 Euro* pro zu beheizendem Quadratmeter rechnen. Soll die Wärme dann von einer Solarthermieanlage kommen, müssen auch hierfür die entsprechenden Kosten eingeplant werden.
Sollte die Betonkernaktivierung nicht die gesamte Heizlast tragen können, muss ein weiteres Heizsystem zur Unterstützung installiert werden. Auch diese Kosten müssen also unter Umständen berücksichtigt werden.
Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen des allgemeinen Aufwandes, lohnt es sich nicht, den Beton nachträglich als Speicher umzubauen. Da die Leitungen für die Warmwasserversorgung in den Beton eingelassen werden müssen, wäre eine Nachrüstung quasi einer Kernsanierung gleich. Konkret heißt das: Wände, Decken oder der Boden müssten bis auf den Beton freigelegt werden, mit den Leitungen versehen und anschließend wieder aufbereitet werden.
Noch findet das Heizen mit Bauteilen eher selten Anwendung. Dabei haben sie großes Potenzial und können vor allem in Verbindung mit einer Solarthermieanlage gut genutzt werden. Damit das System in Zukunft gut genutzt werden kann, müssen vor allem die Kosten gesenkt werden und idealerweise auch die Effizienz erhöht.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Inhalte des Artikels wurden nach sorgfältiger Recherche zusammengetragen. Trotzdem können sich die Gesetze stetig ändern. Bitte hab Verständnis dafür, dass Solaridee bezüglich der in diesem Dokument getroffenen Aussagen keine Haftung übernehmen kann.
* Ungefährer Preis inkl. Mwst, zzgl. Versandkosten. Zwischenzeitliche Änderungen sind möglich.